

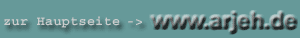
 |
 |
Die fünf Männer der Samaritanerin*Die Beziehung zwischen Jesus und der Tora nach Joh 4,16-19Von Friedhelm WesselDer Aufsatz erschien zuerst in der Zeitschrift Biblische Notizen (BN) Nr. 68 (1993), S. 26-34. Er wurde für diese Veröffentlichung leicht überarbeitet und ergänzt. Die johanneische Erzählung von der Begegnung Jesu mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen (Joh 4,1-42) ist ein Stück großer theologischer Darstellungskunst des vierten Evangelisten. Aus einer ganz alltäglichen Szene entwickelt er ein Geflecht aus sprachlichen, historischen und theologischen Anspielungen und verleiht damit der Episode eine tiefe Symbolik, die das religionsgeschichtliche Verhältnis zwischen Juda und Samaria beleuchtet.[1] Der erzählerische Rahmen der Geschichte ist schnell zusammengefaßt: Auf dem Weg von Judäa nach Galiläa läßt sich Jesus um die Mittagszeit an der Jakobsquelle nieder (4,1-6). Als eine samaritanische Frau zum Wasserschöpfen kommt, entwickelt sich ein intensives Gespräch, das seinen Ausgangspunkt im Verhältnis von Juden und Samaritanern hat, aber bald sein eigentliches Thema findet: die Offenbarung Jesu. Johannes schildert damit offenbar nicht lediglich eine einmalige und individuelle Begebenheit, sondern stellt das Offenbarungsgeschehen in den religionsgeschichtlichen und theologischen Zusammenhang des Volkes Israel. Die Ortsangabe "Quelle Jakobs" (4,6) deutet schon das Thema der Szene an: sie weist nämlich hin auf den gemeinsamen Ursprung von Samaritanern und Juden in ihrem Stammvater Jakob (= Israel). Dort, in diesem Quell Jakobs, begann die Geschichte der zwölf Stämme Israels. Und trotz der späteren Verzweigung ihres Weges durch Eroberung, Verbannung, Exil und Rückkehr bleibt dieser Ursprung das Verbindende zwischen Juda, dem israelitischen Südreich, und Samaria, dem Zehn-Stämme-Reich im Norden, das seinen Namen der alten israelitischen Königsresidenz Schomron verdankt. Die Begegnung zwischen Jesus und der Samaritanerin an diesem Ort ist also eine Begegnung an der gemeinsamen religiösen und geschichtlichen Wurzel. Deshalb kann man sagen: die Topographie der Erzählung zeigt sich uns als eine vor allem theologische Topographie. Das Verhältnis zwischen Juda und Samaria wird auch gleich zu Anfang des Gesprächs zum Thema gemacht. Die Spaltung innerhalb des israelitischen Volkes findet ihren Ausdruck in der verwunderten Frage der Frau, wie denn Jesus als ein Jude von einer Samaritanerin zu trinken begehren könne, denn: "Juden verkehren doch nicht mit Samaritanern" (4,9). Mit dieser Einleitung ist der Rahmen des folgenden Gesprächs abgesteckt. Es geht um die Person Jesu im Spannungsfeld zwischen Juda und Samaria. Damit gewinnt der Rahmen eine entscheidende Funktion für die Deutung der ganzen Szene, insbesondere auch für das Verständnis des im weiteren Verlauf des Gesprächs merkwürdig abrupt einsetzenden kurzen Dialogs zwischen Jesus und der samaritanischen Frau über ihre "Männergeschichten" (Joh 4,16-19). Dem Abschnitt Joh 4,16-19 geht ein längerer Dialog voraus, in dem Jesus der Frau zu erklären versucht, warum nicht er auf ihr Wasser angewiesen ist, sondern sie vielmehr auf das Wasser, das er ihr bieten kann. Dieses "lebendige Wasser" ist geeignet, den existentiellen Durst der Frau zu löschen: Auf diese Bitte der Frau antwortet Jesus nun nicht direkt, sondern wendet sich scheinbar einem ganz anderen Thema zu: Es stellt sich die Frage, warum Johannes hier plötzlich das Thema "lebendiges Wasser" verläßt und scheinbar zu einem ganz anderen Bereich wechselt. Wir wollen diese Frage behutsam angehen, und zunächst nur einige grundsätzliche Beobachtungen zu den fraglichen Versen machen:
Diese Beobachtungen führen zu folgendem vorläufigen Schluß: Der Dialog dient einerseits der Feststellung, daß die Frau zur Zeit des Gesprächs keinen (rechtmäßigen) Mann hat. Man kann die Intention der Frage Jesu dann dahingehend beschreiben, daß dies für ihn ein durchaus mangelhafter Zustand ist: offensichtlich sollte die Frau einen richtigen, d.h. ihr zugehörenden Mann haben. Andererseits wird diesem jetzigen Zustand die Tatsache gegenübergestellt, daß die Frau einmal fünf Männer gehabt hat. Jesus redet aber mit keinem Wort davon, daß dies ebenfalls eine unzureichende Situation gewesen wäre, oder gar als verwerflich anzusehen sei. Wer sind dann die fünf Männer? In der Exegese gibt es dazu zwei vorherrschende Meinungen, die jeweils geprägt sind von der Beantwortung der Frage, ob der vorliegende Dialog symbolischen Charakter hat oder nicht. Lehnt man eine symbolische Deutung ab, so kommt man zu dem Schluß, es gehe Jesus um eine Aufdeckung der moralisch verwerflichen Ehepraxis der Frau[2], um sie damit für seine messianische Offenbarung (4,26) vorzubereiten[3]. Dabei spielt der Hinweis auf die rabbinische Auffassung, eine Frau solle sich nur zweimal, höchstens dreimal verheiraten,[4] eine entscheidende Rolle. Ein solches Verständnis kann aber nicht erklären, wieso dann hier von ausgerechnet fünf Männern die Rede ist. Eine Interpretation auf symbolischer Grundlage andererseits erinnert daran, daß laut 2Kön 17,24-34 nach der Zerstörung des Nordreiches Israel durch die Assyrer in Samaria fünf fremde Völker angesiedelt wurden, die neben JHWH ihren eigenen Göttern dienten.[5] Jesu Hinweis auf die fünf Männer der Samaritanerin wäre danach eine Anspielung auf diese götzendienerische Vergangenheit Samarias. Gegen diese exegetischen Auffassungen ist jedoch einzuwenden, daß weder die eine, noch die andere Interpretation die fundamentale Tatsache zur Kenntnis nimmt, daß das Verhältnis der Samaritanerin zu den fünf Männern von Jesus keineswegs als verwerflich hingestellt wird. Solches sollte man aber erwarten für den Fall, daß es hier um Ehemoral oder Götzendienst ginge. Offensichtlich gehört die Erwähnung der Männer also in einen ganz anderen Zusammenhang. Dabei ist noch eine weitere Beobachtung aufschlußreich: Der Text sagt nicht, daß die Frau die Männer nacheinander gehabt habe,[6] es ist daher nicht ausgeschlossen, daß sie alle fünf gleichzeitig hatte. Das führt uns zu folgender Deutung, die aufgrund des oben aufgewiesenen theologischen Grundduktus unserer ganzen Szene mit dem Symbolcharakter sowohl der Samaritanerin, als auch ihrer Männer rechnet: Die fünf Männer der Samaritanerin waren ihre rechtmäßigen Ehemänner, und ihre Namen lauteten: bereschith (Genesis), schemoth (Exodus), wajjiqra (Leviticus), bamidbar (Numeri) und debarim (Deuteronomium)! Es handelt sich um die fünf Bücher Mose, die Tora, denen Samaria (die Samaritanerin repräsentiert das ganze Volk) einst "angetraut" war. Für diese Interpretation können wir uns auf den ältesten existierenden Kommentar zum Neuen Testament, den Johanneskommentar des Origenes berufen. Er identifiziert dort im 13. Buch (Fragment 18) bereits die fünf Männer als die fünf Bücher Moses. Dies ist auch kein sonderlich überraschender Befund, denn bekanntlich bestand die Heilige Schrift der Samaritaner lediglich aus dem Pentateuch. Es muß hier nicht auf die umstrittene Frage der historischen Einordnung des "samaritanischen Schismas" eingegangen werden, ebensowenig auf die Erörterung der Kanongeschichte des Pentateuchs.[7] Entscheidend für uns bleibt die Tatsache, daß die Samaritaner "den Pentateuch - mit wenigen Ausnahmen - als Offenbarung vom Sinai übernommen und ihn, wie im Judentum dann die Sadduzäer, als einzige verbindliche Offenbarungsgrundlage gewertet"[8] haben. Dies sind die vormaligen fünf Männer der Samaritanerin bei Johannes, und es gibt keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß der johanneische Jesus diese Verbindung der Frau mit dem offenbarenden Wort Gottes in der Tora für richtig gehalten hat. Das hat auch schon Origenes so gesehen. C.K. Barrett hat nun gegen eine solche Deutung eingewendet: "Daß Joh auf die Annahme der fünf Bücher der Tora als die allein kanonischen durch die Samaritaner verwies, ist unwahrscheinlich, da die Samaritaner diese Bücher nicht aufgegeben hatten, und es wäre schwierig, den einen, der kein Ehemann ist, zu identifizieren"[9]. Dies sind zwei berechtigte und schwerwiegende Argumente. Beide jedoch lassen sich mit Hilfe des Evangelientextes selbst entkräften. Zunächst sei hervorgehoben: es ist eine Sache, die religionsgeschichtliche Tatsache herauszustellen, daß die Samaritaner ihre Tora nicht aufgegeben haben, eine andere aber, die Interpretation des johanneischen Jesus zu beachten. Halten wir uns ausschließlich an den Text des Evangeliums, so läßt sich mit ziemlicher Sicherheit daraus schließen, daß Jesus bei Johannes sehr wohl der Auffassung ist, die Samaritanerin habe jetzt keine Verbindung (mehr) zur Tora. Entscheidend dafür ist der Sinn von Joh 4,10, wo Jesus auf den verwunderten Einwurf der Frau reagiert, daß er als ein Jude von ihr zu trinken begehrt (4,7), wo doch Juden (aus Reinheitsgründen) nicht mit Samaritanern verkehren (4,9): Wir finden dann in dieser Rede Jesu eine Aussage, die die Kenntnis der Tora und die Kenntnis Jesu parallel setzt: "Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir sagt ...". Beide Satzteile sind durch ein "und" verbunden. Das heißt aber: Das Verhältnis zwischen Jesus und der Tora ist kein antithetisches, sondern ein synthetisches. Genau der gleiche synthetische Parallelismus liegt auch schon im Johannesprolog vor: "Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden - die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden" (1,17).[12] An beiden Stellen gibt es weder faktisch noch sinngemäß eine adversative Konjunktion[13], die die Satzglieder einander gegenüberstellen und so die Qualitäten "Gnade und Wahrheit" bzw. "lebendiges Wasser" allein dem Wirken Jesu vorbehalten und damit implizit der Tora absprechen würde. Das Johannesevangelium ist also der Auffassung, die Samaritanerin entbehre der wahren und ihr rechtmäßig zugehörenden göttlichen Offenbarung in der Tora. Der johanneische Jesus vermißt bei ihr diesen "Mann", der in der Lage wäre, den Durst nach "lebendigem Wasser" zu stillen. Die bloße Tatsache, daß der "Quellgrund" Samarias in der Herkunft vom israelitischen Stammvater Jakob liegt, garantiert durchaus noch nicht, daß man nach dem Trinken aus dieser Quelle Jakobs nicht erneut dürstet (Joh 4,13). Und solchen Durst verspürt die Frau ganz offensichtlich: "Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und hierherkommen muß, um zu schöpfen" (4,15). Jesus wird hier aufgefordert, als Spender des Wassers den existentiellen Mangel der Frau zu beheben. Nun findet man an anderen Stellen des Johannesevangeliums ähnliche Aussagen über das "Dürsten" und das "ewige Leben", die außerordentlich aufschlußreich sind für das Verständnis unserer Szene. So heißt es Joh 6,35: "Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals mehr dürsten". Wir erkennen hier einen deutlichen inhaltlichen Zusammenhang mit Joh 4,14. Zwar kennt das Evangelium keine Aussage Jesu: "Ich bin das Wasser des Lebens", aber in 6,35 kann man ohne Schwierigkeiten ergänzen: So wie Jesus als das Brot des Lebens den Hunger auf ewig stillt, so stillt er als das Wasser des Lebens den Durst. Solche Nahrung, heißt es vorher bereits in 6,27, "die bleibt ins ewige Leben, die wird euch der Menschensohn geben". Der Ausdruck "ins ewige Leben" findet sich wörtlich auch in 4,14. Darüber hinaus wiederholt es 6,53f in einem parallelen Bild: "Amen, Amen, ich sage euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht eßt und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch zu sich nimmt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben". Hier entspricht nun das Fleisch dem hungerstillenden Brot aus 6,35 und folgerichtig kann man das Blut mit dem durstlöschenden Wasser identifizieren. Das heißt aber jetzt: Jesus bietet den Hungernden und Dürstenden nicht nur Brot und Wasser als Objekt an, er ist es vielmehr selbst! Wer von Jesus Brot und Wasser erhält, erhält ihn selbst - sein Fleisch und Blut. Damit erklärt sich sofort der Sinn von Joh 4,16-19: Jesu Frage nach dem Mann der Samaritanerin will die Frau auf diesen personalen Zusammenhang hinweisen. Die Frau verlangt das Wasser des Lebens von Jesus, er aber vermittelt ihr hintergründig die Botschaft: Ich selbst bin es, den du brauchst (vgl. 4,26: "Ich bin's, der mit dir redet"). Das heißt letztlich: Jesus selbst ist der rechte Mann für die Samaritanerin. Diese Einsicht ermöglicht es nun, auch den zweiten Einwand Barretts gegen die symbolische Gleichsetzung der fünf Männer mit der Tora aufzulösen, die Schwierigkeit nämlich, den einen, der nicht ihr Mann ist, zu identifizieren. Offenbar ist doch derjenige, den die Frau "jetzt hat" niemand anderer als Jesus. Der Text von 4,16-18 sagt zweimal deutlich, sowohl im Munde der Frau, als auch von Jesus: Die Samaritanerin hat keinen Mann. Tatsächlich aber hat sie doch in diesem Augenblick (nûn - V.16) einen, der zwar nicht ihr "Mann" ist, der es aber werden soll: Jesus, der das lebendige Wasser ist! Damit erklärt sich auch der abrupte Übergang von V.15 nach V.16 - ein Themenwechsel liegt hier nur scheinbar vor, in Wirklichkeit führt Jesus das offenbarende Gespräch über das lebendige Wasser nur auf einer anderen Ebene weiter.[14] Sowohl die fünf Männer, als auch der "eine Mann" Jesus sind dieses lebendige Wasser und folglich grundsätzlich dazu geeignet, den Durst der Frau zu stillen. Die Pointe des Dialogs zwischen Jesus und der Samaritanerin besteht also darin, daß Jesus sich der Frau als der wahre "Mann" anbietet. Unter Berücksichtigung der Rede von den fünf Männern heißt das: Wo die Tora als Spenderin lebendigen Wassers nicht vorhanden ist, da ist Samaria jetzt auf Jesus angewiesen. Die heilsgeschichtliche Bedeutung Jesu - nicht nur für die Samaritanerin - kann man dann so zusammenfassen: Jesu Sendung geschieht mit dem Ziel, denen Wasser zum ewigen Leben zu bringen, die anders - nämlich durch die Tora - keinen Zugang dazu haben: So ist er der "wahre Retter der Welt" (Joh 4,42). Zu dieser Welt, die allein auf die Offenbarung in Jesus angewiesen ist, kann aber dann nicht das Judentum gehören, sofern es sich auf seine Tora stützt. Daß im Johannesevangelium auch von Juden erzählt wird, die ihre Tora nicht kennen, ist mit Blick auf die vehementen Streitgespräche zwischen "den Juden" und Jesus (s. Joh 5,10-47; 7,14-31; 8,30-59; 10,31-39) völlig fraglos. Das Entscheidende an diesen Auseinandersetzungen liegt aber doch gerade darin, daß diese Juden von Jesus gekennzeichnet werden als Ignoranten gegenüber der Tora und ihrer eigenen religiösen Tradition (s. 5,45; 7,19; 8,39-40; 10,34-36); eben deshalb haben sie ja Jesus nötig. Wenn man aber behaupten wollte, das gesetzestreue Judentum, das die Tora tut und darauf hört (Ex 24,7), benötige in Jesus einen Offenbarer und Heilsmittler über die Tora hinaus, so wäre das m.E. theologischer Unfug, für den sich keine Rechtfertigung im Johannesevangelium finden läßt. Der Unterschied zwischen dem Wort Gottes in der Tora und dem Wort Gottes in Jesus besteht nicht dem Inhalt nach, denn beide sind sie als göttliche Offenbarungen "lebendiges Wasser"; sie unterscheiden sich lediglich durch ihre jeweiligen Adressaten: Die Tora war und ist an Israel gerichtet, Jesus richtet sich an die zerstreuten Kinder Israels (hier die Samaritaner) und die Heiden (vgl. Joh 11,50-52). Nach Johannes ist das tora-treue Judentum nicht Zielobjekt, sondern Ausgangspunkt der Sendung Jesu. Das drückt Joh 4,22 ganz unmißverständlich aus, wenn sich dort Jesus mit den Juden identifiziert: "Wir (die Juden!) beten den an, den wir kennen, denn: Das Heil ist aus den Juden". Wenn ich zu Anfang meiner Überlegungen feststellen konnte, daß die Ortsbeschreibung der Szene mit der Samaritanerin (der Jakobsbrunnen) eine theologische Topographie darstellt, so läßt sich jetzt abschließend das gleiche für den Weg Jesu von Jerusalem über Samaria nach Galiläa (Joh 4,3-4) sagen: Das Itinerar Jesu nach Johannes ist ein heilsgeschichtlich-soteriologisches.[15]Es beschreibt den Heilsweg Jesu vom Zentrum (Jerusalem und das Judentum) über die Peripherie ersten (Samaria) und zweiten Grades (Galiläa) hin zu der heidnischen Außen-Welt, die schließlich im Kreuz erreicht wird. Sinn und Ziel des Weges Jesu ist das "Sammeln der zerstreuten Kinder Gottes (Israels) in eines" (Joh 11,52) und die Rettung der Heiden - "damit nicht das ganze Heidenvolk[16] zugrundegehe" (Joh 11,50). Überraschenderweise erfolgt diese maßgebliche Deutung des Todes Jesu im Johannesevangelium durch den jüdischen Hohenpriester Kaiphas, der von Johannes klar und deutlich als Prophet bezeichnet wird. Es mag für Christen - zumal nach Jahrhunderten antijüdischer Polemik - höchst unangenehm und geradezu anstößig sein, daß Johannes ihnen die entscheidende Deutung der Sendung Jesu ausgerechnet im Mund des jüdischen Hohenpriesters vorlegt. Wenn aber aus den grauenvollen Verfolgungen, denen Juden christlicherseits ausgesetzt waren, irgendeine Lehre zu ziehen ist, so besteht sie in der unvoreingenommenen Revision der biblischen Glaubensurkunden selbst.[17] Revision bedeutet eine Lektüre unter geändertem Blickwinkel. Gerade das Johannesevangelium bietet dazu ein hervorragend geeignetes Feld.[18] Denn Johannes gilt in der Exegese auch heute noch als der "Vater des Antisemitismus der Christen"[19]. Meine Überlegungen wollen zeigen, daß diese Einschätzung vielleicht mehr über die Tendenz der christlichen Auslegungsgeschichte aussagt, als über den Verfasser des vierten Evangeliums. Das Johannesevangelium erweist sich als die Buchstabierung des Wortes Gottes im spannungsvollen Rahmen der Beziehung zwischen jüdischer und außerisraelitischer (heidnischer) Welt. Johannes - beim Wort genommen - könnte heute im Zentrum des christlich-jüdischen Dialogs stehen, wenn man nur bereit wäre, sich neu auf ihn einzulassen.[20] [*] Ich verwende hier durchgängig die Bezeichnung Samaritaner/Samaritanerin. Im Deutschen hat sich seit einigen Jahren der Name Samariter bzw. Samariterin durchgesetzt. Bedauerlicherweise unterstützt der Duden diese Entwicklung und verzeichnet lediglich noch die Form Samariter/Samariterin. Andere deutsche Wörterbücher folgen ihm hierin jedoch nicht (z.B. der Wahrig). Auch in der Fachliteratur wird in der Regel die Schreibweise Samaritaner bevorzugt. Die Form Samariter oder Samariterin ist historisch wohl durch Luthers Übersetzung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter/Samaritaner (Lk 10,30-37) populär geworden. [1] Darauf weist bereits hin: H. Odeberg, The Fourth Gospel. Interpreted in its relation to contemporaneous religious currents in Palestine and the hellenistic-oriental world, Uppsala 1929 (Nachdruck Amsterdam 1974), 177: "The symbolical character of the controversial dialogue with the Samaritan woman can scarcely be doubted". Vgl. auch B. Olsson, Structure and Meaning in the Fourth Gospel. A textlinguistic analysis of John 2:1-11 and 4:1-42, Lund 1974. [2] So z.B. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 1. Teil. Freiburg, Basel, Wien 1965 (=HThK 4/1), 467-469. Schnakenburg spricht von der "moralischen Gesunkenheit" der Frau (a.a.O., 468) und von "dem ihr peinlichen Thema" (a.a.O., 469), obwohl er andererseits feststellt: "Jesu Bemühen richtet sich zuerst nicht darauf, die Frau von ihrem sündhaften Lebenswandel abzubringen, sondern sie für seine Offenbarung empfänglicher zu machen" (a.a.O., 467). Jedenfalls aber weiß Schnackenburg mit seiner moralischen Deutung hier entschieden mehr als der Evangelist. [3] So etwa J. Becker, Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1-10. Gütersloh/Würzburg 1985 (=ÖTK 4/1), 173-174. Hier wird betont, daß das Darstellungskonzept des Evangelisten (bzw. der Semeia-Quelle) einem christologischen Anliegen folge, bei dem die Frau nur dienende Funktion habe (a.a.O., 173). Es gehe in erster Linie um den Aufweis, daß Jesus "die prophetische Gabe der Allwissenheit" (ebd.) besitze, womit das christologische Bekenntnis der Frau (4,29) eingeleitet werde. Becker hält es so für unangebracht, eine "moralische Aburteilung" der Frau in den Text "hineinzulesen" (ebd.). [4] Zitiert bei Strack-Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Bd.2. München 1924, 437. [5] Vgl. für diese Interpretation C.K. Barrett, Das Evangelium nach Johannes, Göttingen 1990 (=KEK Sonderband), 253-254. Kritisch dazu: Becker, Johannes, ÖTK 4/1, (s. Anm. 3), 173-174, der insbesondere darauf verweist, daß in 2Kön 17,30-31 zwar von fünf Völkern, aber sieben Göttern berichtet wird. [6] Solches behauptet zwar Schnackenburg (Johannes, HThK 4/2, [s. Anm. 2], 467), aber das ist offenbar eine notwendige Schlussfolgerung aus seiner ethischen Wertung, die am Text nicht verifizierbar ist. [7] S. dazu H.G. Kippenberg, Garizim und Synagoge, in: RVV 30, 1971; R.J. Coggins, Samaritans and Jews. The Origins of Samaritanism Reconsidered. Oxford 1975, 148ff; N. Schur, History of the Samaritans. Frankfurt 1989. [8] J. Maier, Zwischen den Testamenten. Geschichte und Religion in der Zeit des zweiten Tempels. Würzburg 1990 (=Echter Bibel, Ergänzungsband z. AT 3), 53-54. [9] C.K. Barrett, Johannes, (s. Anm. 5), 253. [10] H. Odeberg, Fourth Gospel, (s. Anm. 1), 150. Odeberg führt die rabbinischen Belegstellen an: BerR 6,7; bBerakoth 5a; Mek 27e; Sifre 35d.36a; jQid 65c; jSanh 23d (a.a.O., 150-151). [11] Zitiert bei Strack-Billerbeck, Kommentar Bd.2 (s. Anm. 4), 435 (vgl. das weitere reichhaltige Belegmaterial dazu 433-436); vgl. auch Odeberg, Fourth Gospel, (s. Anm. 1), 154-163. [12] Dies hat H. Thyen festgestellt: "Das Heil kommt von den Juden", in: D. Lührmann, G. Strecker (Hg.), Kirche (FS G. Bornkamm). Tübingen 1980, 163-184: 173. [13]Die Konjunktion "de", die nach P66 in 1,17b zu finden ist, muß nicht notwendigerweise einen Gegensatz anzeigen, da de" "häufig "als reine Übergangspartikel, ohne irgendwie bemerkbaren Gegensatz" steht (Blaß-Debrunner, Grammatik des ntl. Griechisch. Göttingen 1990, § 447,1f). [14] Das hat auch Konsequenzen für die Frage der literarischen Quellenlage in unserem Abschnitt. Becker (Johannes, ÖTK 4/1, [s. Anm. 3], 166) will mit der Abfolge 4,5-9ab.16-19 eine sinnvolle Erzählung der Semeia-Quelle erkennen und begründet die Quellenscheidung u.a. mit dem "offenkundigen" Bruch zwischen V.15 und 16. M.E. ist dies ein Paradebeispiel dafür, wie man mit einer mechanischen, statt einer theologischen Methode der Auslegung auf exegetische Holzwege geraten kann. [15] S. dazu M. Rissi, Die Hochzeit in Kana (Joh 2,1-11), in: F. Christ (Hg.), Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie (FS O. Cullmann). Hamburg 1967, 76-92: 82-84; vgl. auch H.-P. Heekerens, Die Zeichenquelle der johanneischen Redaktion. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des vierten Evangeliums. Stuttgart 1984 (=SBS 113), 129-130; H. Thyen, "Heil", (s. Anm. 12), 174-175. [16] Das griechische "ethnos" bezeichnet nach biblischem und insbesondere johanneischem Sprachgebrauch in erster Linie nicht Israel oder das Judentum, sondern gerade in Abgrenzung dazu die außerisraelitische Völkerwelt und ist dann als "Heidenvolk" zu übersetzen. [17] S. dazu F.W. Marquardt, Von Elend und Heimsuchung der Theologie. Prolegomena zur Dogmatik. München 1988, 124-147, besonders 139. [18] Vgl. den in "Kirche und Israel" jüngst erschienenen Aufsatz von J. Schonefeld, Die Thora in Person, (KuI 6 [1991], 40-52), der eine neue Lektüre des Johannesprologs als einen "Beitrag zu einer Christologie ohne Antisemitismus" vorschlägt. [19] G. Baum, Die Juden und das Evangelium. Zürich 1963, S. 146. [20] Die vorstehenden Überlegungen verdanken sich der Einrichtung eines (inzwischen abgeschlossenen) exegetischen Forschungsprojekts über die angebliche Judenfeindschaft des Johannesevangeliums bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Aachen. Für ihr Engagement sei der Gesellschaft deshalb auch an dieser Stelle herzlich gedankt. |
|
|
